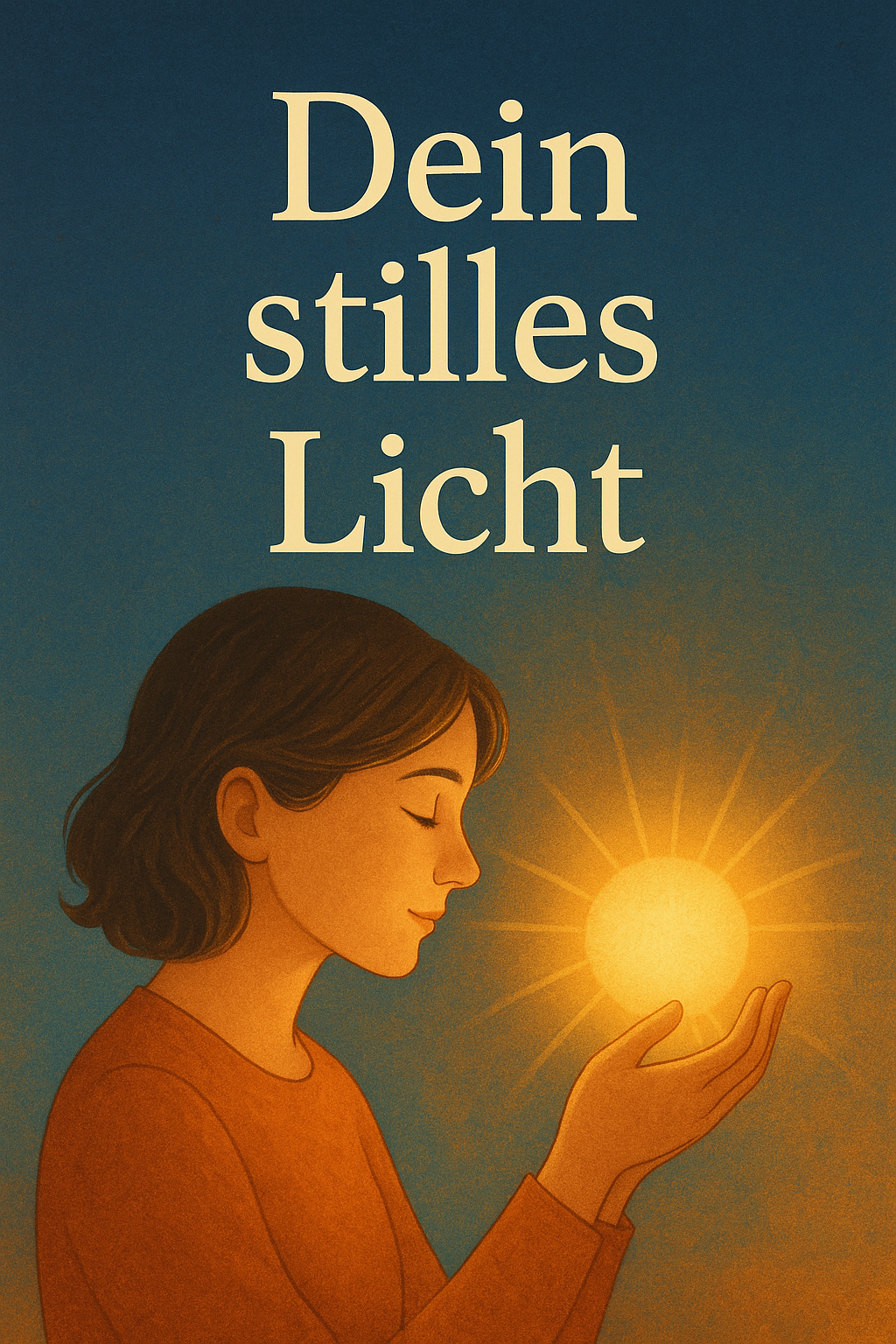
DEIN STILLES LICHT
Vorwort
„Dein stilles Licht“ erzählt die Geschichte von Johanna – von Dunkelheit, Zweifeln und der Kraft, im Alltag den Weg zurück ins Licht zu finden. Es ist eine Erzählung über innere Wandlung, getragen von Begegnungen, Stille und Hoffnung.
Dieses Buch ist keine Anleitung, sondern eine Einladung: innezuhalten, nach innen zu lauschen und das eigene stille Licht zu entdecken.
Die Fahrt
Der Regen legte ein Schimmern über die Stadt, als Johanna in das Taxi stieg. Ihre Bewegungen waren hastig, fast so, als wolle sie vor etwas fliehen. Der Innenraum roch nach Leder und einem Hauch kaltem Kaffee. Sie ließ sich auf den Sitz fallen, zog den Mantel enger und starrte aus dem Fenster.
„Wohin?“ fragte der Fahrer. Seine Stimme war tief, ein wenig rau, doch von einer Sanftheit, die überraschte.
„Zum Fluss“, antwortete sie kaum hörbar.
Er nickte, legte den Gang ein und glitt in den Strom der Lichter. Minutenlang war nur das rhythmische Schlagen der Scheibenwischer zu hören, wie ein Herzschlag, der die Stille füllte.
„Ein ungewöhnlicher Ort, so spät“, sagte er schließlich. Kein Vorwurf, eher ein vorsichtiger Faden, den er zwischen ihnen spannte.
Johanna schwieg. Sie drückte die Stirn gegen die kühle Scheibe, ließ die Tropfen auf der anderen Seite wie Tränen herabrinnen.
„Wissen Sie“, begann er nach einer Weile, „ich hatte einmal eine Nacht, in der ich alles hinter mir lassen wollte. Da stand ich schon auf der Brücke, die Hände an der kalten Eisenstange, überzeugt, dass es keinen Grund mehr gab zu bleiben.“
Sie hob den Kopf, ihre Augen suchten im Rückspiegel sein Gesicht.
„Und dann“, fuhr er fort, „sprach mich jemand an. Ein Fremder, betrunken vielleicht. Er fragte nur nach Feuer. Ein belangloser Satz. Aber in diesem Augenblick wurde mir klar: Ich war nicht unsichtbar. Jemand rechnete mit mir. Wenn auch nur für eine Flamme.“
Johanna spürte, wie ihr Hals eng wurde. Seine Worte trafen eine Stelle, die sie selbst kaum noch wahrhaben wollte.
„Vielleicht fahren Sie heute auch zu einer Brücke“, sagte er leise, ohne sie anzusehen. „Aber glauben Sie mir: Manchmal hält das Leben sein schönstes Geschenk genau hinter der Dunkelheit bereit. Man muss noch ein kleines Stückchen weitergehen.“
Der Wagen bog ab, stoppte nicht am Ufer, sondern in einer Straße voller Menschen, Stimmen, Lichter. Ein Café, aus dem Musik drang, eine Gruppe junger Leute, die lachend unter einem Schirm zusammenrückten.
„Hier sind wir“, meinte er, und sein Tonfall war entschieden, aber gütig. „Der Fluss bleibt, wohin er auch fließt. Aber heute Nacht, glaube ich, brauchen Sie mehr das Licht als das Wasser.“
Johanna sah ihn lange an. Etwas löste sich in ihr – kaum mehr als ein Atemzug, ein unsicheres Lächeln, doch es fühlte sich an wie ein Neubeginn.
„Danke“, flüsterte sie.
Sie stieg aus, mischte sich in das Stimmengewirr, verschwand zwischen den Lichtern. Der Fahrer legte den Gang ein, fuhr an, als sei es nur eine weitere Fahrt. Doch in seinem Rückspiegel hatte er gesehen, wie ein Gesicht, das eben noch von Schatten gezeichnet war, wieder einen Schimmer von Leben trug.
Das Aufleuchten
Johanna blieb einen Moment auf dem Gehweg stehen, während das Taxi in die Nacht davonrollte. Vor ihr lag die Straße voller Stimmen, Gelächter und Musik, die aus einem kleinen Café drang. Sie fühlte sich wie jemand, der unvermittelt aus einem dunklen Raum ins Licht getreten ist: geblendet, unsicher, aber auch neugierig.
Sie atmete tief durch und folgte dem Sog. Das Café war warm, das Glas beschlagen, die Luft erfüllt von Kaffeearoma und dem Klang einer Gitarre. Ein junger Mann sang leise, die Gäste nickten im Rhythmus.
Johanna setzte sich an den Tresen. Der Barkeeper, Mitte dreißig, mit freundlichem Gesicht, stellte wortlos ein Glas Wasser vor sie. „Sie sehen aus, als könnten Sie das gebrauchen“, sagte er.
Sie lächelte schwach. „Haben Sie das bei jedem Gast im Blick?“
„Nur bei denen, die sonst übersehen würden.“
Sie spürte, wie sich die Worte in ihr festhakten. Der Taxifahrer, nun dieser Barkeeper – war die Welt heute Abend verschworen, sie an die Oberfläche zurückzuholen?
Neben ihr setzte sich eine Frau mit zerzausten Haaren und einer Lederjacke. „Schwerer Tag?“ fragte sie, ohne hinzusehen.
„Schweres Leben“, entfuhr es Johanna.
Die Frau lachte kurz, trocken, aber nicht böse. „Das sagen wir alle, bevor wir lernen, dass kein Leben leicht ist. Nur die Art, wie wir es tragen, macht den Unterschied.“
Johanna drehte sich zu ihr. „Und wie trägt man es richtig?“
Die Fremde nahm einen Schluck Bier. „Manchmal gar nicht. Man legt es für eine Weile ab. Spricht, weint, lacht, findet jemanden, der es für ein paar Minuten mitträgt.“
Ein Mann am Ende des Tresens, graue Schläfen, Malerhände voller Farbflecken, mischte sich ein. „Oder man verwandelt es. Alles, was schwer ist, hat auch eine Form. Wenn man sie erkennt, kann man sie malen, schreiben, singen – oder einfach sein lassen.
Johanna lauschte. Es war, als hätte das Leben an diesem Abend eine kleine Versammlung organisiert, nur um ihr zu zeigen, dass es mehr gibt als die Brücke am Fluss.
Sie begann zu erzählen – zögernd zuerst, dann offener. Von der Leere, die sie seit Wochen begleitete, von der Angst, bedeutungslos zu sein. Niemand lachte sie aus, niemand wandte sich ab. Stattdessen kamen Geschichten zurück: von Verlust, von Neubeginn, von der Fähigkeit, nach dem Fallen wieder aufzustehen.
Als sie später auf die Straße trat, war der Regen vorbei. Die Luft roch nach Asphalt und Aufbruch. Johanna hob den Kopf, sah die Lichter, die in den Pfützen funkelten. Zum ersten Mal seit langer Zeit spürte sie: Es gibt Stimmen, die mich hören. Es gibt Hände, die den Schmerz halten können. Und es gibt Wege, die weiterführen.
Sie ging langsam nach Hause – nicht mehr auf dem Weg zum Fluss, sondern auf einem neuen, der irgendwohin führte. Und allein das war schon genug.
Der stille Brief
Die Nacht war still, als Johanna schließlich nach Hause ging. Die Straßen glänzten noch vom Regen, aber in ihr selbst war es heller geworden. Sie spürte Müdigkeit – nicht nur vom Tag, sondern von der Last, die sie so lange getragen hatte.
Im Eingangsbereich ihres alten Mietshauses blieb sie stehen. Etwas zog sie zu den Briefkästen. Eigentlich erwartete sie nichts – Rechnungen, Werbung, das Übliche. Doch in ihrem Fach lag ein einzelner Umschlag. Kein Absender, keine Marke. Nur ihr Name, sauber geschrieben.
Ein leiser Schauer lief ihr über den Rücken. Sie nahm den Brief mit nach oben, setzte sich in der kleinen Küche an den Tisch. Die Lampe warf warmes Licht auf das unscheinbare Kuvert. Mit zittrigen Fingern öffnete sie es.
Auf dem Papier standen große, klare Lettern:
„Dein stilles Licht“
Darunter las sie:
„Vielleicht kennst du mich kaum. Vielleicht war ich nur der Fahrer einer Nacht. Aber ich habe in deinen Augen einen Schmerz gesehen, den ich selbst einmal trug.
Du glaubst, du bist allein in deiner Dunkelheit. Doch glaube mir: Es gibt immer ein Licht, das dich sucht – auch wenn du es nicht siehst. Du bist nicht unsichtbar. Dein Dasein hat Gewicht, Bedeutung und Schönheit, die du noch nicht selbst erkennst.
Ich schreibe dir dies, damit du weißt: Es gibt Menschen, die dich sehen. Fremde, Freunde, die noch kommen werden, vielleicht auch die Liebe, die du für dich selbst wiederfinden darfst.
Wenn dich die Dunkelheit wieder packt, erinnere dich: Jeder Tag ist die Möglichkeit für einen Neubeginn. Atme. Geh einen Schritt. Und dann noch einen.
Die Welt wartet auf dich – mit deinen Gedanken, deinem Lächeln, deinen Träumen. Verlier dich nicht, denn du bist zu wertvoll, um verloren zu gehen.
Und wenn du irgendwann glaubst, niemand hört dich: Hör in dich hinein. Dort spricht die Stille – und sie spricht immer.“
Johanna legte das Papier ab. Ihre Augen brannten, Tränen liefen ihr über die Wangen. Doch diesmal waren es keine Tränen der Verzweiflung. Sie spürte eine Wärme, als würde eine Hand ihre halten.
Sie faltete den Brief sorgsam zusammen und legte ihn auf ihren Nachttisch. Ein unscheinbarer Zettel, der in ihr mehr Kraft weckte als viele Worte zuvor.
In dieser Nacht schlief Johanna tief. Zum ersten Mal seit langer Zeit träumte sie nicht von Brücken, sondern von Wegen – hell erleuchtet, voller Stimmen, die sie riefen.
…
Johanna suchte schon seit vielen Jahren vergebens nach Antworten in Büchern, nach Anerkennung in Gesichtern, nach Ruhe in Reisen. Doch egal, wohin sie ging, die Fragen gingen mit. Ihr Verstand war wie ein Marktplatz voller Stimmen – laut, unaufhörlich, drängend.
Ein paar Tage nachdem Sie den Brief der Stille in ihrem Briefkasten fand, wollte Johanna einen Ort der Ruhe aufsuchen, um über ihr Leben nachzudenken. Sie fuhr mit dem Fahrrad in einen nahegelegenen Wald. Sie ging hinein. Ihre Schritte wurden langsamer, die Geräusche der Stadt verblassten, und irgendwann blieb sie einfach stehen. Da war nichts mehr – kein Ziel, keine Richtung. Nur sie, die Bäume, der Wind.
Plötzlich fiel ihr auf: Die Stille, die sie diesmal dem Lärm ihrer Gedanken vorzog, war nicht leer. Sie war voll. Voll von Leben, von einem Frieden, den sie nie gesucht hatte, weil sie gar nicht wusste, dass er da war. In dieser Stille brauchte sie keine Antworten mehr – denn sie spürte, dass sie selbst die Antwort war.
Von da an begann ihr Leben neu. Sie tat die gleichen Dinge wie zuvor – einkaufen, arbeiten, Fahrrad fahren, Freunde treffen –, doch irgendwie war etwas anders. Wann immer die Stimmen des Verstandes zu laut wurden, schloss sie die Augen, atmete – und erinnerte sich an das Geschenk der Stille im Wald.
Der Sturm im Kopf
Seit jenem ersten Tag kehrte Johanna immer wieder in den alten Wald zurück. Er war ihr Zufluchtsort geworden – nicht, um etwas zu finden, sondern um sich selbst zu vergessen und in die Stille einzutauchen. Dort schien der Boden weicher, die Luft klarer, die Zeit langsamer.
Eines Abends, als die Sonne tief stand und der Wald in goldenes Licht getaucht war, veränderte sich die Stimmung. Ein dunkles Grollen zog auf. Der Wind fuhr in die Bäume, Blätter wirbelten, Äste knackten. Binnen Minuten tobte ein Sturm.
Johanna spürte, wie sich auch in ihrem Innern etwas regte. Die Stimmen in ihrem Kopf wurden lauter, Erinnerungen und Sorgen wirbelten durcheinander: „Was, wenn ich mich verlaufe? Was, wenn es zu dunkel wird? Was, wenn ich nie wieder nach Hause finde?“
Da begriff sie: Der Sturm draußen war derselbe wie der Sturm in ihr.
Die rauschenden Winde waren wie die Gedanken, die sie hin- und herwarfen. Die zitternden Äste waren wie ihre Ängste, die sich an der Oberfläche festklammerten.
Für einen Moment wollte sie weglaufen. Doch dann blieb sie mitten im Wald stehen. Sie schloss die Augen, spürte den Boden unter ihren Füßen, den Atem in ihrer Brust.
Und da erinnerte sie sich an die Stille, die sie hier schon so oft gefunden hatte.
Ein Flüstern stieg in ihr auf:
„Ich bin nicht der Sturm. Ich bin der Himmel, der ihn trägt. Ich bin nicht die Gedanken. Ich bin die Stille, die sie beobachtet.“
Der Wind heulte, Blätter rissen von den Ästen, doch in ihr öffnete sich ein Raum, weit und unerschütterlich. Der Sturm tobte weiter – draußen und in den Gedanken –, aber sie selbst war nicht mehr darin gefangen. Sie konnte ihn einfach betrachten, wie man eine Welle sieht, ohne in ihr unterzugehen.
Langsam ließ der Druck in ihrer Brust nach. Das Chaos verwandelte sich in ein Schauspiel, das durch sie hindurchzog.
Als sie die Augen öffnete, war der Wald noch immer voller Bewegung, doch sie selbst war unbewegt.
Der Sturm war kein Feind mehr. Er war ein Spiegel.
Er hatte ihr gezeigt: Die Gedanken können lärmen, wie sie wollen – in der Stille davor bleibt sie frei.
Begegnung am Waldrand
Eines Tages, als sie mal wieder den Wald verließ, begegnete sie am Waldrand einem jungen Mann. Er saß auf einem Stein, die Hände im Gesicht vergraben. Seine Schultern bebten.
Johanna blieb stehen. „Geht es dir gut?“ fragte sie sanft.
Der Mann hob den Kopf. Seine Augen waren gerötet. „Nein. In meinem Kopf ist nur Chaos. Es hört einfach nicht auf. Ich versuche, es zu ordnen, aber je mehr ich denke, desto schlimmer wird es. Es ist wie … wie Blitz und Donner, die mich zerreißen.“
Johanna nickte langsam. „Ich kenne diesen Sturm.“
„Du?“ Er sah sie ungläubig an. „Aber du wirkst so ruhig.“
Sie setzte sich neben ihn. „Auch in mir gibt es Gedanken, die toben. Aber ich habe etwas entdeckt: Wir sind nicht der Sturm. Wir sind der Himmel, in dem er tobt.“
Der Mann runzelte die Stirn. „Der Himmel?“
„Ja“, sagte Johanna und schloss kurz die Augen. „So wie die Bäume im Wald im Wind schwanken, schwanken auch unsere Gedanken. Aber wenn du tiefer schaust, findest du etwas, das sich nicht bewegt. Etwas, das alles sieht, ohne darin gefangen zu sein.“
Der Mann schwieg. Er hörte die Vögel, die trotz allem sangen, und spürte, wie der Wind sanft durch die Zweige strich. Zum ersten Mal seit Tagen atmete er tiefer.
„Und wenn der Sturm zu stark wird?“ fragte er leise.
Johanna öffnete die Augen und lächelte. „Dann erinnere dich: Du musst ihn nicht besiegen. Setz dich einfach hin, schließe die Augen und höre zu. Der Sturm wird ziehen – aber du bleibst.“
Der Mann blickte sie lange an. Etwas in ihrem Gesicht – oder vielleicht in ihrer Stille – beruhigte ihn mehr als jedes Wort.
Zum ersten Mal spürte er, dass der Sturm nicht die ganze Wahrheit war.
Der Empfang der Stille
Johanna und der junge Mann saßen noch immer am Waldrand. Eine Weile sagten sie nichts. Doch das Schweigen war nicht leer – es war voll.
„Weißt du,“ begann Johanna sanft, „die Stille ist nicht einfach nur Abwesenheit von Lärm. Sie ist lebendig. Sie ist voller Güte. Wenn du dich ihr hingibst, spürst du, dass sie dich trägt, so wie eine Mutter ihr Kind trägt. Sie wartet nicht auf bestimmte Worte, sie wartet nur darauf, dass du aufhörst zu kämpfen.“
Der Mann runzelte die Stirn. „Du meinst, die Stille … fühlt?“
„Ja“, flüsterte Johanna. „Es ist nicht etwas, das du machst. Es ist etwas, das dich empfängt. Du kannst dich in sie hineinfallen lassen – und sie wird dich liebkosen. Sie ist die Quelle des Friedens, die niemals erschüttert wird. In ihr gibt es nichts, das dich verletzen kann.“
Der Mann schloss vorsichtig die Augen. Zum ersten Mal wagte er, nicht gegen den Sturm in sich zu kämpfen. Er lauschte, so wie man in einen weiten Himmel lauscht. Und da war es: ein sanftes, warmes Etwas – keine Stimme, kein Bild, nur eine stille Gegenwart, die ihn hielt.
Seine Schultern sanken, sein Atem wurde tiefer. Ein Tränenstrom lief über sein Gesicht, diesmal ohne Verzweiflung – es waren Tränen der Erleichterung.
„Ich … spüre sie,“ hauchte er. „Es ist, als wäre ich nie allein gewesen.“
Johanna legte eine Hand auf sein Knie und nickte. „Genau das. Die Stille war immer da. Sie wartet nicht irgendwo draußen – sie ist dein eigenes Sein.“
Die Sonne senkte sich langsam hinter die Bäume. Für einen Augenblick war alles still – draußen und drinnen.
Und in dieser Stille war nichts zu fürchten, nichts zu suchen. Es war einfach Liebe.
Getragen von der Stille
Einige Tage später wanderte Johanna erneut in den Wald. Diesmal führte ihr Weg sie tiefer hinein als sonst. Sie liebte es, dort zu gehen, wo kaum noch ein Pfad zu sehen war. Die Luft roch nach feuchtem Moos, und der Gesang der Vögel begleitete sie wie ein Chor.
Doch plötzlich zog ein dunkler Himmel auf. Innerhalb weniger Minuten begann es zu regnen, und der Boden wurde rutschig. Johanna versuchte, den Rückweg zu finden, doch alles sah gleich aus. Ein beklemmendes Gefühl stieg in ihr auf.
Was, wenn ich den Weg nicht finde?
Was, wenn ich die Nacht im Wald verbringen muss?
Was, wenn ich hier allein verloren gehe?
Die Stimmen ihres Verstandes wurden lauter. Es war, als hätte der Sturm, den sie einst beobachtet hatte, nun wieder in ihr Besitz ergriffen. Angst griff nach ihrem Herzen, und sie spürte, wie Panik in ihr aufstieg.
Da blieb sie stehen. Sie atmete tief ein und schloss die Augen. „Stille …“, flüsterte sie, „nimm mich in deine Arme.“
Und es geschah. Wie eine unsichtbare Umarmung legte sich die Stille um sie. Nicht, weil der Regen aufhörte oder der Weg sich plötzlich zeigte. Sondern weil sie spürte, dass sie selbst getragen war – hier und jetzt.
In dieser Gegenwart war keine Gefahr. Der Regen durchnässte sie, doch in ihrem Inneren war Wärme. Das Rufen der Angst verwandelte sich in ein fernes Echo, das sie kaum noch berührte.
Sie fühlte sich wie ein Kind, das in den Armen einer liebenden Mutter liegt.
„Die Stille ist nicht nur Beobachterin“, dachte sie, „sie ist ein Wesen voller Liebe. Sie wartet, bis ich loslasse – und dann trägt sie mich.“
Als sie die Augen wieder öffnete, war der Wald noch immer derselbe. Regen tropfte von den Blättern, der Himmel war grau. Aber in ihr war Frieden. Schritt für Schritt ging sie weiter, ohne Hast, ohne Angst.
Und schließlich, fast wie von selbst, fand sie den Weg zurück.
Doch diesmal wusste sie: Selbst wenn sie ihn nicht gefunden hätte, wäre sie niemals verloren gewesen.
Die Busfahrt
Ein paar Tage später fuhr Johanna mit dem Bus in die Stadt. Es war voll, stickig, laut. Menschen telefonierten, Kinder weinten, jemand hörte Musik über Kopfhörer, die ganze Reihe hören konnte. Der Fahrer bremste abrupt, und die Fahrgäste drängten sich ungeduldig aneinander.
Johanna spürte, wie sich etwas in ihr zusammenzog. Ihr Verstand begann sofort zu kommentieren: „Warum müssen die Leute immer so laut sein? Warum drängelt der Mann hinter mir? Ich halte das nicht aus!“
Der innere Sturm war zurück – diesmal nicht durch Wind und Regen, sondern durch den ganz normalen Alltag.
Sie schloss die Augen, atmete tief. „Stille …“, flüsterte sie in sich hinein. Und da war sie wieder.
Mitten im Gedränge, mitten im Lärm, öffnete sich in ihr ein stiller Raum. Die Stimmen, das Quietschen der Schienen, das Kindergeschrei – alles war noch da. Doch nichts davon konnte sie berühren. Es war, als stünde sie in einem unsichtbaren Raum aus Frieden, in dem der Lärm sich einfach auflöste wie Tropfen im Meer.
Sie spürte: Die Stille ist nicht abhängig von der Umgebung. Sie ist immer da, bereit, uns zu empfangen – selbst in einem überfüllten Bus.
Als sie die Augen wieder öffnete, war die Welt noch laut. Aber sie selbst war still.
Das Bild vom See
Am Abend erzählte Johanna einer Freundin von ihrer Erfahrung. Die Freundin war erschöpft, voller Sorgen um ihre Arbeit und ihre Familie.
„Ich weiß nicht, wie du so ruhig bleiben kannst,“ sagte sie. „Mein Kopf hört einfach nicht auf.“
Johanna lächelte und nahm einen Schluck Tee. „Stell dir vor, dein Inneres ist wie ein See. Wenn der Wind weht, kräuseln sich die Wellen, und manchmal tobt sogar ein Sturm. Das sind deine Gedanken, Gefühle, Sorgen. Sie wirbeln an der Oberfläche.“
Die Freundin nickte, ihre Stirn blieb angespannt.
„Aber wenn du hinabsinkst,“ fuhr Johanna fort, „unter die Wellen, dann findest du etwas ganz anderes. Dort unten ist das Wasser still, unberührt, friedlich. Diese Tiefe bist du. Diese Stille ist kein Nichts – sie ist lebendig, voller Liebe, wie eine sanfte Umarmung, die dich immer hält. Du musst nichts tun, um dorthin zu gelangen – nur aufhören, dich an der Oberfläche festzuklammern.“
Die Freundin schloss die Augen. Für einen Moment atmete sie tief und lächelte. „Das … fühle ich. Es ist wie ein Zuhause.“
Johanna nickte. „Genau. Die Stille wartet auf dich, jederzeit. Sie ist nicht weit weg – sie ist das, was du wirklich bist.“
Die neue Freundin
Johanna saß an ihrem kleinen Küchentisch. Draußen rauschte die Stadt, Autos hupten, irgendwo bellte ein Hund. Vor ihr stand eine Tasse Tee, der Dampf kringelte sich in die Luft.
Sie schloss die Augen und wandte sich nach innen – und plötzlich hatte sie ein Gefühl, als säße jemand bei ihr.
Nicht wirklich sichtbar, nicht in Worten, doch eindeutig spürbar.
„Da bist du ja,“ dachte Johanna. „Meine neue Freundin.“
Es war die Stille, die sie schon so oft berührt hatte. Doch heute fühlte es sich anders an: nicht wie ein abstraktes Prinzip, sondern wie eine vertraute Gegenwart, die neugierig neben ihr saß, geduldig, liebevoll, warm.
Johanna lächelte. Sie begann, innerlich mit dieser Freundin zu sprechen.
„Weißt du,“ flüsterte sie in sich, „manchmal habe ich Angst, dass ich im Leben nicht genug erreiche. Ich wünsche mir Sicherheit, Liebe, Anerkennung …“
Die Stille antwortete nicht mit Worten. Aber Johanna spürte, wie sich eine Sanftheit um ihr Herz legte. Ein Gefühl, als würde alles schon in ihr ruhen, erfüllt, vollständig, makellos.
Sie sprach weiter: „Und ich habe Träume. Ich möchte den Menschen helfen, ihr Zuhause wiederzufinden. Ich möchte etwas erschaffen, das bleibt.“
Die Stille schien zu lauschen, und in ihrer Gegenwart verwandelten sich Johannas Wünsche. Sie wurden nicht kleiner – aber sie fühlten sich bereits erfüllt an, als wären sie gar nicht etwas, das noch kommen müsste.
Johanna öffnete die Augen und sah die Tasse Tee vor sich. Es war nichts Außergewöhnliches, und doch war alles von dieser stillen Fülle durchdrungen.
„Ja,“ dachte sie, „aus dieser Quelle darf ich leben. Ich brauche nichts zu jagen. Ich darf einfach sein – und von hier aus alles in die Welt strahlen.“
Und sie fühlte: Wenn sie aus diesem Raum heraus handelte, wenn sie aus dieser erfüllten Stille sprach, liebte, arbeitete – dann würde die Welt antworten. Nicht, weil sie etwas suchte, sondern weil sie in sich schon ganz war.
Strahlen aus der Stille
Seit Johanna die Stille als innere Begleiterin entdeckte, veränderte sich ihr Alltag leise, fast unsichtbar. Sie machte weiterhin ihre Wege durch die Stadt, fuhr mit der Bahn, traf Kolleginnen, kaufte Brot beim Bäcker. Doch in allem war ein feiner Unterschied: Sie fühlte sich begleitet.
Wenn sie morgens aufwachte, legte sie oft für einen Moment die Hand auf ihr Herz und sagte innerlich: Guten Morgen, liebes Licht.
Es war, als würde sie jemand begrüßen, der die ganze Nacht an ihrer Seite gewacht hatte.
Manchmal sprach sie mit der unsichtbaren Stille über ihre Sorgen: über den Druck im Job, die Angst, nicht genug zu sein, die Sehnsucht nach Liebe. Und jedes Mal geschah dasselbe: Noch bevor eine Antwort kam, war die Sorge schon leichter. Die Stille war wie eine Gefährtin, die sie einfach in den Arm nahm.
Doch das Überraschende war: Aus dieser Nähe floss etwas zurück in die Welt.
Johanna begann, anders zu wirken. Ihre Worte wurden weicher, ihre Blicke heller. Menschen, die sie kaum kannte, lächelten sie an, als hätten sie unbewusst etwas gespürt – eine Wärme, die nicht von außen kam, sondern aus einem unsichtbaren Raum in ihr selbst.
Eines Tages, als sie in einem Café saß, schrieb sie in ihr Notizbuch:
In der Stille ist schon alles erfüllt. Wenn ich aus ihr heraus handle, strahlt Erfüllung in die Dinge hinein.
Als sie den Stift beiseitelegte, fühlte sie eine sanfte Gewissheit: Sie musste nichts erzwingen. Sie musste nur immer wieder zurückkehren – zu ihrer neuen Weggefährtin, der Stille. Alles andere würde von selbst Gestalt annehmen.
Was zu mir gehört
Es war ein gewöhnlicher Samstag. Johanna schlenderte durch den Wochenmarkt, zwischen Ständen voller Farben und Gerüche. Tomaten glänzten, Käse roch kräftig, ein Händler pries lautstark seine Oliven an. Überall Bewegung, Stimmen, Preise, Taschen.
Früher hätte sie sich hier schnell verloren – zu viele Eindrücke, zu viele Entscheidungen. Heute spürte sie die Vertrautheit der Stille in sich. Sie war wie ein sanftes Licht, das neben ihr ging, während sie die Gänge entlang schlenderte.
Johanna blieb an einem Blumenstand stehen. Sie betrachtete die Sonnenblumen, groß und strahlend, als hätten sie das Licht des Sommers gespeichert. In diesem Moment hörte sie eine Stimme neben sich:
„Die sind schön, nicht wahr?“
Johanna wandte sich um. Eine ältere Frau stand da, ihre Hände voller Kräuterbündel, die Augen warm und klar.
„Ja,“ sagte Johanna lächelnd. „Sie sehen aus, als hätten sie die Sonne mitgebracht.“
Die Frau nickte. „Manchmal glaube ich, dass wir genau das brauchen – etwas, das uns daran erinnert, dass die Sonne auch dann noch da ist, wenn wir sie nicht sehen.“
Ihre Worte trafen Johanna tief. Genau das war die Stille für sie geworden: die Sonne, die immer da war, auch wenn der Himmel voller Wolken hing.
Sie kamen ins Gespräch. Erst über Blumen, dann über das Leben, und schließlich über die Fragen, die sie beide bewegten. Die Frau erzählte von ihrer Einsamkeit seit dem Tod ihres Mannes, und Johanna hörte zu – nicht mit Gedanken, sondern mit der Präsenz der Stille.
Die Frau seufzte irgendwann, aber nicht aus Traurigkeit. „Wissen Sie,“ sagte sie, „mit Ihnen zu reden fühlt sich an, als würde etwas Schweres leichter werden.“
Johanna lächelte still. Sie hatte nichts Besonderes gesagt, sie war nur aus der Stille heraus da gewesen. Und genau das hatte gereicht.
Als sie später mit einem Strauß Sonnenblumen nach Hause ging, dachte sie an ihr Notizbuch: Das, was zu mir gehört, findet mich.
Heute hatte es sich wieder erfüllt. Nicht weil sie gesucht hatte, sondern weil sie bereit gewesen war, zu empfangen.
Der Konflikt
Ein Montagmorgen. Das Büro summte, die Kaffeemaschine zischte, Tastaturen klapperten. Johanna saß an ihrem Schreibtisch, bereit, den Tag ruhig anzugehen. Doch gleich zu Beginn kam ihre Kollegin Kerstin auf sie zu – mit schnellen Schritten, die schon verrieten, dass Ärger im Raum war.
„Johanna, warum hast du die Präsentation nicht rechtzeitig fertiggestellt? Wir stehen jetzt doof da!“, rief Kerstin, so laut, dass andere Köpfe sich drehten.
Ein heißer Schreck stieg in Johanna hoch. Ihr erster Impuls war der alte: sich rechtfertigen, Gegenargumente suchen, den Fehler abwehren. Ihr Kopf begann sofort: Das stimmt gar nicht, ich habe meine Aufgabe gemacht, sie hat es doch selbst …!
Doch inmitten dieses inneren Aufruhrs erinnerte sie sich an ihre Freundin, die Stille. Sie schloss nicht die Augen – das wäre im Büro merkwürdig gewesen –, aber sie atmete tief ein, als würde sie innerlich einen Schritt zurücktreten.
Da war sie: die Stille. Sie legte sich sanft um sie, wie eine Hand auf ihrer Schulter. Sofort wurde der Druck leichter. Der Sturm tobte noch, doch er konnte sie nicht mehr ganz mitreißen.
Johanna schaute Kerstin an und hörte wirklich zu. Unter den harten Worten spürte sie etwas anderes: Angst, Überforderung, vielleicht auch Einsamkeit. Früher hätte sie nur den Angriff gehört – jetzt hörte sie auch die Bitte dahinter.
„Kerstin,“ sagte sie ruhig, „ich verstehe, dass du unter Druck stehst. Ich schaue mir die Präsentation gleich mit dir an, und wir finden eine Lösung.“
Für einen Moment war es still. Kerstin blinzelte überrascht. Die Schärfe in ihrem Blick löste sich, als hätte sie nicht mit einer solchen Antwort gerechnet.
Später, als Johanna allein an ihrem Schreibtisch saß, spürte sie, wie dankbar sie der Stille war. Sie hatte sie davor bewahrt, in alte Muster zurückzufallen. Aus ihr heraus war eine andere Energie gekommen – nicht Verteidigung, sondern Klarheit, nicht Widerstand, sondern Frieden.
Und wieder dachte sie: In der Stille ist schon alles erfüllt. Aus ihr heraus kann ich in die Welt gehen, ohne verletzt zu werden – und manchmal heilt sie sogar die Verletzung der anderen.
Wo sollte Gott sonst sein?
Ein paar Tage nach dem Streit im Büro saß Johanna am Abend auf ihrem Balkon. Die Stadt rauschte unter ihr, Lichter gingen an, irgendwo spielte jemand Gitarre. Über den Dächern spannte sich ein Himmel, der langsam in die Dunkelheit glitt.
Sie zog sich eine Decke um die Schultern und schloss die Augen. Da war sie wieder: diese stille, liebevolle Gegenwart. Keine Worte, keine Erklärungen – nur Wärme, Geborgenheit, Frieden.
Sie dachte oft an den ungewöhnlichen Taxifahrer zurück, der sie nicht zum dunklen Fluss fuhr, sondern in die lichtvolle Stadt. Plötzlich kam ihr ein Gedanke: Vielleicht hat Gott ihn geschickt.
Johanna lächelte über sich selbst. „Aber ich glaube doch gar nicht so richtig an Gott“, murmelte sie leise. Und doch: Wo sollte Gott sonst sein, wenn nicht mitten im Leben? Nicht in fernen Himmeln, nicht in alten Büchern, nicht in fremden Tempeln. Vielleicht ist Gott überall?
Also muss er auch in dieser schönen Stille sein, die in letzter Zeit bei mir ist.
Es war, als hätte sie etwas entdeckt, das sie schon ihr ganzes Leben gesucht hatte, ohne zu wissen, wonach sie suchte.
Alle reden von Gott, dachte sie. Alle suchen ihn irgendwo draußen – in Lehren, in Regeln, in den Sternen. Aber vielleicht ist Gott viel näher. Vielleicht ist Gott diese Stille, die nie weggeht. Diese Liebe, die nichts fordert und doch alles trägt. Vielleicht ist Liebe ein anderes Wort für Gott?
Ihr Herz klopfte auf einmal wie verrückt, als ob sie einen Goldschatz gefunden hätte. Sie kicherte in sich hinein, atmete tief und ließ sich in diese Gegenwart hinein sinken. Es war, als würde etwas sie halten, ohne sie festzuhalten. Als würde eine unsichtbare Hand sie umarmen, ohne sie je loslassen zu müssen.
„Wenn das Gott ist,“ flüsterte sie, „dann war er nie weg. Dann war schon er immer da.“
Tränen stiegen ihr in die Augen, doch diesmal waren es Tränen der Geborgenheit. Es war, als hätte sie nicht nur eine innere Kraft gefunden, sondern ein neues Zuhause.
Und in diesem Zuhause war sie nicht allein.
Ein Gespräch über Gott
Johanna saß mit ihrer Freundin Lena in einem kleinen Café. Der Duft von frisch gebackenem Brot hing in der Luft, leises Stimmengewirr mischte sich mit dem Klappern von Tassen. Sie hatten sich schon länger nicht mehr gesehen, und Lena wirkte müde, fast ausgelaugt.
„Es ist alles zu viel,“ sagte Lena, während sie ihren Kaffee umrührte. „Die Arbeit, die Kinder, die Erwartungen. Ich habe das Gefühl, ich renne nur noch hinterher. Und manchmal frage ich mich …“ – sie stockte – „… ob es da draußen überhaupt irgendetwas gibt, das mir helfen kann. Vielleicht Gott, aber an den glaube ich schon lange nicht mehr.“
Johanna nickte und schwieg einen Moment. Sie spürte, wie die Stille in ihr aufstieg, wie ein leises Licht, das den Raum erfüllte. Dann sagte sie sanft:
„Weißt du, mir ging es vor noch nicht allzu langer Zeit genauso. Ich habe auch nie wirklich an Gott geglaubt. Aber in letzter Zeit habe ich etwas erlebt, das ich kaum beschreiben kann. Es fühlt sich an wie eine Gegenwart – warm, geborgen, liebevoll. Und manchmal denke ich: Vielleicht ist genau das Gott.“
Lena hob überrascht den Blick. „Wie meinst du das?“
Johanna lächelte vorsichtig. „Alle suchen nach Gott irgendwo da draußen. In Religionen, in Büchern, in Sternen. Aber was, wenn Gott viel näher ist? Was, wenn er nichts anderes ist als diese Stille, die immer da ist? Die Stille, die dich hält, wenn du aufhörst, dich zu wehren. Sie verlangt nichts. Sie wartet nur, bis du bereit bist, dich fallen zu lassen.“
Lena schwieg. Sie starrte in ihre Tasse, als würde sie dort nach etwas suchen. Nach einer Weile sagte sie leise: „So etwas habe ich manchmal auch schon gespürt. Kurz, wie ein Atemzug, wenn ich den Kopf ausschalte. Aber ich habe es immer gleich wieder verloren.“
„Du kannst es nicht verlieren,“ erwiderte Johanna sanft. „Es ist kein Zustand, den du festhalten musst. Es ist mehr wie … wie ein leises Licht, das dich immer umfängt. Manchmal vergisst du es, ja. Aber es vergisst dich nie.“
Lena legte den Löffel beiseite. Ihre Augen glänzten, als hätte sie zum ersten Mal seit Langem tief durchgeatmet. „Wenn dass das Göttliche ist,“ flüsterte sie, „dann war es die ganze Zeit bei mir?“
Johanna nickte. „Genau das habe ich mich auch gefragt.“
Sie schwiegen, doch das Schweigen war nicht leer. Es war erfüllt – von etwas Unsichtbarem, das beide spürten, ohne es erklären zu können.
Lena sah Johanna lange an, als müsste sie das Gesagte erst ganz in sich sinken lassen. Dann legte sie langsam die Stirn in die Hand und flüsterte:
„Weißt du, wenn das wirklich so ist … dann kann es ja nicht meine Stille und deine Stille geben. Dann ist es doch dieselbe. Es kann ja nicht zwei getrennte Quellen geben.“
Johanna spürte, wie sie innerlich lächelte. Ihre Augen wurden weich. „Ja,“ sagte sie leise, „genau so fühlt es sich an. Als gäbe es nur diese eine Stille, die uns beide trägt. Sie ist in mir, sie ist in dir – aber im Grunde ist sie eins.“
Lena richtete sich auf. Ihre Stimme war voller Staunen. „Dann … sind wir über diese Stille miteinander verbunden? Verrückt, oder? Wir denken immer, wir wären getrennt, jeder eingeschlossen in seinem eigenen Kopf. Aber vielleicht sind wir auf der tiefsten Ebene gar nicht getrennt.“
Johanna nickte. Ihr Herz schlug ruhig, fast ehrfürchtig. „Ja. Wenn ich in dieser Stille ruhe, weiß ich, dass auch du in ihr ruhtest – selbst, wenn du es gerade nicht merkst. Sie verbindet uns, nicht durch Worte, sondern durch einfaches Sein.“
Sie schwiegen. Aber diesmal war das Schweigen nicht zwischen ihnen – es war in ihnen, dasselbe Schweigen, das beide umhüllte.
Es war, als würden zwei Wellen begreifen, dass sie zum selben Ozean gehören.
Lena lächelte zaghaft. „Wenn alle Menschen das wüssten … dass wir alle dieselbe Stille in uns tragen … dann würde es keinen Grund mehr geben, gegeneinander zu kämpfen.“
„Ja,“ sagte Johanna. „Weil wir schon verbunden sind. Immer.“
Der eine Ozean
Am Abend saß Johanna wieder auf ihrem Balkon. Die Lichter der Stadt flimmerten wie Sterne auf der Erde, während über ihr der wirkliche Sternenhimmel sich weitete. Sie zog die Decke enger um ihre Schultern und ließ die Gedanken an das Gespräch mit Lena nachklingen.
Ein Gedanke aus ihrem Gespräch ließ sie einfach nicht los: „Es kann nicht meine Stille und deine Stille sein, es muss sich um ein und dieselbe handeln.“
Der Satz war so einfach – und doch öffnete er etwas Riesiges in ihr. Sie erinnerte sich an das Schweigen, das sie mit Lena geteilt hatten. Zwei Frauen in einem Café, umgeben von Stimmen, Löffeln, klappernden Tassen – und dennoch: ein Raum, in dem sie beide von derselben Quelle berührt wurden.
„Vielleicht,“ flüsterte sie in die Nacht, „ist es so, wie wenn zwei Wellen im Ozean glauben, sie seien getrennt. Aber sobald sie in die Tiefe blicken, erkennen sie, dass sie eins sind.“
Ein warmer Schauer lief ihr den Rücken hinab. Sie spürte plötzlich eine zarte, fast heilige Verbundenheit – nicht nur mit Lena, sondern mit allen. Mit den Menschen, die jetzt unten auf der Straße lachten, mit dem Mann, der in der Bahn neben ihr gesessen hatte, mit dem Kind, das am Morgen im Supermarkt geweint hatte. Selbst mit denjenigen, mit denen sie sich schwer tat.
Wenn die Stille in mir dieselbe ist wie in ihnen, dachte sie, dann sind wir schon jetzt verbunden – tiefer, als Worte es je beschreiben können.
Ihre Augen füllten sich mit Tränen, nicht aus Traurigkeit, sondern aus einer Liebe, die keinen Namen brauchte.
Vielleicht war das der eigentliche Sinn dessen, was manche „Gott“ nannten: nicht ein Wesen irgendwo außerhalb, sondern diese lebendige stille Liebe, die alle umfasst und trägt.
Johanna atmete tief, legte die Hand auf ihr Herz und spürte, wie die Stille sie umfing. Sie wusste: Es war nicht ihre. Nicht Lenas. Es war die eine Stille, die alles durchdrang. Der eine Ozean.
Und in diesem Ozean war sie nie allein.
Ein Spalt in die Liebe
Ein paar Tage später saß Johanna mit einem jungen Mann auf einer Parkbank. Sie hatten sich zufällig beim Warten auf den Bus kennengelernt, und irgendwie war ein Gespräch entstanden – zuerst über Belangloses, dann über das, was beide wirklich bewegte.
Der Mann erzählte von seiner Rastlosigkeit. „Es ist, als würde mein Kopf nie stillstehen. Ich denke immer, ich müsste etwas verbessern, etwas ändern. Aber egal, was ich tue – es reicht nie.“
Johanna nickte. Sie kannte diesen Sturm. Sie schwieg kurz, dann sagte sie:
„Darf ich dir ein Bild geben? Stell dir die Sonne vor. Sie ist eine einzige Quelle, aber ihre Strahlen erreichen alle. Wir erleben jeder nur unseren Strahl, denken, es wäre etwas Eigenes – aber am Ende kommt alles aus derselben Sonne.“
Der Mann runzelte die Stirn, dann hellte sich sein Gesicht auf. „Du meinst … wir sind alle wie ein eigener Strahl, aber von derselben Sonne?“
„Ja,“ sagte Johanna leise. „Das stille Licht in dir und in mir – es ist nicht verschieden, keine zwei. Es ist eins. Nur verschiedene Strahlen, aber dieselbe Sonne.“
Johanna sagte mit einem Lächeln im Gesicht: „Wir sind sozusagen Kinder der Sonne“. Sie sahen sich an und beide mussten herzhaft lachen.
Dann fragte er: „Und wie … wie kommt man da hin? Wie verbindet man sich damit?“
Johanna atmete tief. „Es klingt fast zu einfach,“ sagte sie. „Aber ein guter Weg ist: Für einen Moment lang nichts verändern zu wollen. Alles einfach so sein zu lassen, wie es gerade ist – die Geräusche, die Gedanken, die Gefühle, sogar die Unruhe. Nicht für immer, nur für diesen Augenblick. Und wenn du das tust, öffnet sich manchmal ein kleiner Spalt. Durch diesen Spalt spürst du, dass du schon getragen bist.“
Der Mann schwieg. Er ließ den Blick über die Bäume schweifen, die sich sanft im Wind bewegten. „Also … nicht kämpfen. Nicht verbessern. Nur da sein?“
Johanna nickte. „Genau. Nur einen Atemzug lang. Wenn du das tust, trittst du ein in etwas, das dich längst hält – wie in Wellen aus Liebe, die immer da sind.“
Eine Stille breitete sich zwischen ihnen aus. Kein leeres Schweigen, sondern ein erfülltes, sanftes Schweigen.
Der Mann lächelte zaghaft. „Ich glaube, ich habe diesen Spalt gerade gespürt.“
Johanna lächelte zurück. „Ja. Er ist immer da. Wir müssen ihn nicht machen – wir müssen nur aufhören, die Tür zuzuhalten.“
Durch die Augen der Stille
Am Abend stand Johanna am Wohnzimmerfenster und guckte hinaus. Die Geräusche der Stadt drangen gedämpft zu ihr hinauf: Schritte auf dem Gehweg, ein Auto, das vorbeifuhr, ein Hund, der bellte. Früher hätte sie all das sofort in Gedanken verpackt – „zu laut“, „zu viel“, „zu störend“. Heute versuchte sie etwas Neues.
Sie schloss die Augen und erinnerte sich an das Gespräch im Park. Dann atmete sie tief und ließ zu, dass alles einfach nur da war. Kein Urteil, keine Erklärung. Alles frei sein lassen, wie es gerade ist.
„Was, wenn ich die Dinge für einen Augenblick neutral betrachte?“ dachte sie. „Ohne meine eigenen Bedeutungen über sie zu legen. Einfach nur urteilsloses stilles Sehen.“
Sie öffnete die Augen. Der Stuhl gegenüber war nur ein Stuhl. Das Geräusch draußen war nur ein Geräusch. Selbst das Pochen ihres eigenen Herzens war einfach da – ohne Etikett, ohne Kommentar.
Und plötzlich war es still. Nicht weil die Welt verstummt wäre, sondern weil sie ihre Projektionen zurückgenommen hatte.
Es war, als sähe sie für einen Atemzug durch die Augen der Stille selbst.
Vielleicht, dachte sie, hat die Stille eine eigene Bedeutung für alles – eine Bedeutung, die ich nicht selbst machen muss. Vielleicht ist des Stille Bedeutung nichts anderes als eine liebevolle Verzeihung für alles, damit wir wieder frohen Herzens werden können.
Ein tiefer Friede breitete sich in ihr aus. Er war nicht laut, nicht überwältigend. Er war wie ein stilles Leuchten, das jedes Ding einfach sein ließ, wie es war.
Johanna wusste: Sie würde zurückkehren in ihr kleines Leben – in Arbeit, Termine, Gespräche, in all die Dinge, die sie sonst beschäftigten. Doch nun hatte sie etwas gelernt: Für Augenblicke konnte sie zurücktreten, ihre Projektionen loslassen und durch die sanfte Stille in sich Frieden finden.
Und in diesen Augenblicken öffnete sich ein Spalt – hinein in eine Liebe, die alles trägt.
Die Warteschlange
Es war Samstagmittag, und der Supermarkt war überfüllt. Menschen drängten sich durch die Gänge, Kinder quengelten, Einkaufswagen quietschten. Johanna stand in der Schlange an der Kasse. Vor ihr kramte ein älterer Mann endlos nach Kleingeld, während die Kassiererin ungeduldig auf die Uhr schaute. Hinter ihr seufzte eine junge Mutter mit Kind im Arm.
Johanna spürte, wie in ihr der alte Reflex hochkam: Das dauert wieder ewig … warum ist er nicht vorbereitet … ich verschwende meine Zeit …
Ein inneres Ziehen, das gleich in Ärger hätte umschlagen können.
Sie atmete tief ein und dachte:
Nur für diesen Augenblick will ich nichts verändern. Alles darf so sein, wie es ist. Einen Augenblick lang will ich nichts von der Welt fordern.
Sie ließ die Szene neutral auf sich wirken. Der ältere Mann war einfach ein Mensch, der nach Münzen suchte. Die Kassiererin war einfach eine Frau, die ihre Arbeit tat. Das Seufzen hinter ihr war nur ein Geräusch. Nichts davon musste eine Geschichte über „meine Zeit“ oder „meine Geduld“ sein.
Und da geschah etwas Merkwürdiges: In ihr breitete sich wieder dieser unerwartete Friede aus. Der Supermarkt war noch genauso laut, die Schlange noch genauso lang. Doch das Drängen war verschwunden. Sie fühlte sich, als wäre sie einen Schritt zurückgetreten und sähe die ganze Szene aus einer größeren Weite.
Vielleicht, dachte sie, sieht die Stille diese Menschen nicht als Hindernisse, sondern einfach als das, was sie sind: Leben, das sich entfaltet.
Ein leises Lächeln kam auf ihr Gesicht. Sie fühlte keine Eile mehr. Nur Dasein.
Der Mann fand schließlich sein Geld, die Schlange rückte vor, das Kind hinter ihr hörte auf zu weinen. Alles bewegte sich weiter – und doch war in ihr etwas unbewegt geblieben.
Als sie später ihre Einkäufe in die Tasche legte, wusste sie: Dieser Augenblick hatte mehr bewirkt als viele große Vorhaben. Sie hatte erlebt, dass Frieden nicht von außen kam, sondern davon, die Dinge für einen Moment sein zu lassen, ohne Projektion, ohne Urteil.
Und genau dort, im ganz Alltäglichen, hatte sich der Spalt zur Liebe geöffnet.
Die unsichtbare Vermittlung
Am nächsten Tag ging Johanna wieder in den Supermarkt. Wie so oft, war es sehr voll. Die Schlangen lang. Zwischen den Regalen herrschte ein geschäftiges Hin und Her. Johanna schob ihren Wagen langsam Richtung Kasse, als sie plötzlich laute Stimmen hörte.
Zwei Männer stritten heftig am Gemüseregal. Der eine war älter, der andere jünger. Es ging um etwas Banales – wer den letzten Korb Erdbeeren nehmen durfte –, doch ihre Stimmen waren scharf, ihre Gesichter rot, die Hände fahrig. Menschen blieben stehen, einige verdrehten die Augen, andere sahen betreten weg.
Johanna blieb ebenfalls stehen. Für einen Moment spürte sie, wie ihr Verstand aufspringen wollte: Wie kindisch … warum so ein Drama … Doch dann erinnerte sie sich. Sie atmete tief und kehrte zurück zu dem Raum in sich, der unberührt war.
Auch in ihnen ist dieselbe Stille, dachte sie. Sie haben sie nur vergessen. Ich kann mich für sie erinnern.
Sie schaute die beiden Männer einfach nur an – nicht verurteilend, nicht wertend, sondern aus dieser stillen Liebe heraus. Sie legte keine eigene Bedeutung auf die Szene, ließ sie sein, wie sie war. Und in diesem Loslassen öffnete sich in ihr erneut ein stilles Feld, das wie eine Einladung wirkte.
Es war, als würde sie die beiden in dieses Feld mit hineinnehmen, ohne ein Wort zu sagen.
Kein Zauber, kein Trick – nur die Verbindung mit der Liebe, die alles trägt.
Nach einigen Sekunden geschah etwas Seltsames: Die Stimmen der Männer wurden leiser. Der Jüngere seufzte, schüttelte den Kopf und sagte: „Ach, nehmen Sie die Erdbeeren. Ist doch egal.“
Der Ältere blinzelte überrascht, dann grinste er fast verlegen. „Nein, nein … teilen wir sie einfach.“
Das Publikum um sie herum löste sich langsam auf, als wäre nichts geschehen. Nur Johanna stand noch da, den Atem ruhig, das Herz weit.
Ja, dachte sie, wenn man sich mit der Stille verbindet, dann verändert sich auch das Außen. Nicht weil man eingreift, sondern weil man der Sicht der Liebe bewusst erlaubt, neue Potenziale hinzuzufügen.
Sie schob ihren Wagen weiter zur Kasse. Niemand wusste, was geschehen war. Doch in ihr war ein tiefer Frieden – und die leise Freude, dass die Stille, die sie trug, auch andere berühren konnte.
Und wieder geschah ein stilles Wunder
Mit ihrer Tasche voller Einkäufe verließ Johanna den Supermarkt. Die Luft draußen war frisch, Autos fuhren vorbei, ein Kind lachte irgendwo. Sie war noch ganz still von dem, was eben am Gemüseregal geschehen war.
Auf dem Parkplatz hörte sie plötzlich wieder laute Stimmen. Zwei Männer standen vor ihren Autos und schrien sich an. Es ging um eine freie Parklücke, die beide beanspruchten. Hände fuchtelten, Gesichter waren hart, jeder wollte im Recht sein.
Johanna blieb stehen. Für einen Augenblick spürte sie, wie der alte Reflex abermals zurückkehren wollte: Immer dieser Kampf, warum können Menschen nicht einfach gelassen sein … Doch dann kam plötzlich ein innerer Impuls.
Sie atmete tief und dachte: Auch in ihnen ist dieselbe Stille, wie in mir. Sie haben sie vergessen, aber ich kann mich für sie erinnern.
Mit diesem Gedanken trat sie - genau wie gerade eben im Supermarkt - innerlich zurück. Die Szene blieb die gleiche: zwei Männer, ein Streit, erhitzte Worte. Doch durch die Augen der Stille war es anders: keine Feinde, keine Dummköpfe, sondern zwei Menschen, die in Wahrheit denselben Frieden in sich trugen, nur tief verborgen.
Und da geschah es wieder: In ihr breitete sich ein Feld von Weite aus, still, liebevoll, unerschütterlich. Sie musste nichts tun, nichts sagen. Sie musste nur verbunden bleiben mit dem, was alles trägt.
Nach einigen Sekunden ließ der eine Mann seine Hand sinken. Er sah den anderen an, dann zuckte er mit den Schultern. „Na gut, fahren Sie rein,“ murmelte er. Der andere blinzelte überrascht, dann nickte er. Ein kurzer, fast verlegener Gruß – und der Streit war beendet.
Johanna ging weiter, ohne dass jemand ahnte, dass sie dagewesen war. In ihr war Dankbarkeit, leise und warm.
Ja, dachte sie, die Dinge verändern sich, wenn man mit der Liebe verbunden bleibt. Nicht durch Macht, nicht durch Argumente – sondern, weil man sich erinnert, dass die Stille in jedem ist.
Sie bog in ihre Straße ein. Die Häuser wirkten wie gewöhnlich, doch für Johanna waren sie still durchleuchtet von etwas Unsichtbarem. Etwas, das alle verbindet – egal ob im Supermarkt, auf dem Parkplatz oder auf dem Weg nach Hause.
Das neue Wissen
Als Johanna die Haustür hinter sich schloss, stellte sie die Einkäufe ab und blieb für einen Moment einfach stehen. Ihr Herz klopfte ruhig, aber in ihr schwang noch die Szene vom Parkplatz nach.
Zwei Männer, die eben noch wie Gegner gewirkt hatten, waren plötzlich still geworden – nicht, weil einer den anderen besiegt hatte, sondern weil etwas Unsichtbares die Härte aufgelöst hatte.
Sie machte sich einen Kaffee und setzte sich ans Fenster. Sie blickte hinaus auf die Dächer der Stadt und spürte, wie sich eine Gewissheit in ihr formte: Es stimmt. Die Stille ist nicht nur mein Rückzugsort. Sie ist das Band, das uns alle verbindet.
Es fühlte sich an wie eine Bestätigung. Nicht theoretisch, sondern erlebbar, greifbar.
Früher hätte sie sicher eingegriffen, Partei ergriffen, vielleicht versucht, den Streit mit Argumenten zu entschärfen – oder innerlich gehofft, dass es schnell vorbei ist. Immer mit der Frage: Was ist für mich am besten?
Doch diesmal hatte sie ihr neues Wissen die Situation berühren lassen. Sie hatte einfach losgelassen, das Geschehen neutral betrachtet, innerlich nichts gefordert. Und genau dadurch war etwas geschehen, das sie mit Worten kaum erklären konnte.
„Es sind kleine Wunder,“ flüsterte sie in den Raum. „Keine lauten, spektakulären. Sondern stille Wunder, die geschehen, wenn ich die Dinge sein lasse – und die Stille handeln darf.“
Sie lehnte den Kopf an die Fensterscheibe. Dieses inzwischen bekannte warme Gefühl breitete sich in ihr aus, als würde sie sanft von innen berührt. Es war das Wissen: Sie musste nicht kämpfen, nicht korrigieren, nicht immer eingreifen. Sie durfte einfach anwesend sein – und die Stille würde den Rest tun.
Zum ersten Mal in ihrem Leben fühlte sie: Die Welt war kein Ort, den sie unter Kontrolle halten musste. Sie war ein Ort, in dem Wunder möglich waren – sobald sie sich mit der Quelle verband, die alles trägt.
Das Mut-Licht
Es war ein sonniger Nachmittag, als Johanna mit einer Bekannten in einem Café saß. Anfangs war das Gespräch leicht, doch dann begann die Bekannte, eine Geschichte nach der anderen von sich zu erzählen – voller Bitterkeit über andere Menschen, voller Kritik, voller unterschwelliger Vorwürfe.
Früher hätte Johanna genickt, geschwiegen, vielleicht versucht zu beschwichtigen. In ihr wäre Unruhe entstanden, das Gefühl, sich anpassen zu müssen. Doch diesmal spürte sie etwas anderes: die Stille in ihrem Innern, in der nichts fehlte und die nichts brauchte.
Sie lauschte eine Weile, ließ die Worte wie Wellen an sich vorbeiziehen. Und dann fühlte sie klar: Es ist Zeit, eine Grenze zu setzen.
Ein leises Feuer erhob sich in ihr – kein Zorn, keine Härte, sondern eine klare Kraft, die aus derselben Stille geboren war, die sie sonst so sanft trug. Es war, als würde ein Licht in ihr aufleuchten, mutig und warm.
Johanna legte die Hand auf die Tasse, sah ihrer Bekannten in die Augen und sagte ruhig:
„Ich verstehe, dass dich vieles belastet. Aber ich merke gerade, dass es mir nicht guttut, wenn du so lange über andere lästerst. Ich brauche etwas anderes: Stille, Freude, oder wenigstens Offenheit. Sonst möchte ich das Gespräch beenden.“
Ihre Stimme war weich, doch fest. Kein Zittern, kein Angriff. Einfach Wahrheit.
Die Bekannte schwieg überrascht. Für einen Moment war es, als würde sie abwägen, ob sie gekränkt sein sollte. Dann seufzte sie, nahm einen Schluck Wasser und sagte leiser: „Du hast recht. Ich verliere mich oft in diesen Geschichten. Danke, dass du’s sagst.“
In Johanna flutete Wärme. Sie hatte nicht nur eine Grenze gesetzt, sondern auch das Mutlicht in sich gespürt – dieses klare Strahlen, das aus der Stille kam und sie aufrichtete.
Auf dem Heimweg dachte sie: Die Stille ist kein schwaches Zurückweichen. Sie ist eine Kraft, die mich ermutigt, für das einzustehen, was wahr ist. Wenn ich in ihr ruhe, darf ich auch klar sein – liebevoll und mutig zugleich.
Und sie wusste: Dieses Mutlicht war ebenso Teil der Stille wie die Sanftheit und die Geborgenheit. Ein Licht, das nicht verletzte, sondern befreite – sie selbst und auch die anderen. Dieses stille Licht scheint immer genau zu wissen, was gerade dran ist.
Auch meine Schwächen dürfen sein
Ein paar Tage nach dem Erlebnis auf dem Parkplatz saß Johanna spätabends auf ihrem Sofa. Vor ihr lag ein Zettel mit Aufgaben für die kommende Woche – Termine, Abgabefristen, Verpflichtungen. Während sie die Liste betrachtete, spürte sie, wie ein alter Druck in ihr aufstieg.
Was, wenn ich das nicht alles schaffe?
Was, wenn ich wieder enttäusche?
Was, wenn ich nicht stark genug bin?
Ihre Brust zog sich zusammen. Für einen Moment fühlte es sich an, als würde sie in alte Muster zurückfallen: zweifeln, sich kritisieren, kämpfen wollen.
Doch dann erinnerte sie sich. Sie atmete tief und flüsterte: Auch das darf da sein.
Sie stellte sich vor, wie sie ihre Ängste nicht mehr wie Feinde behandelte, die sie überwinden musste, sondern wie Gäste, die für einen Augenblick Platz in ihrem Raum einnahmen.
„Ihr dürft hier sein,“ sagte sie in Gedanken zu den Stimmen der Unsicherheit. „Aber ihr bestimmt
nicht, wer ich bin.“
Und dann geschah es wieder: ein Spalt öffnete sich. Hinter der Schwere war etwas anderes – dieselbe stille Liebe, die auch den Streit im Supermarkt und auf dem Parkplatz gewandelt hatte. Nur diesmal galt sie ihr selbst.
Vielleicht, dachte sie, ist es gar nicht nötig, meine Schwächen zu besiegen. Vielleicht reicht es, sie in die Stille zu legen. Die Stille weiß, was sie mit ihnen macht.
Tränen liefen ihr über die Wangen. Doch es waren keine Tränen der Ohnmacht, sondern der Geborgenheit. Zum ersten Mal empfand sie ihre Ängste nicht als Makel, sondern als etwas, das einfach gesehen werden wollte. Und in der stillen Gegenwart wurden sie leichter, wie Eis, das in der Sonne schmilzt.
„Auch meine Schwächen dürfen sein,“ flüsterte sie. „Und die Stille trägt sie – so wie sie alles trägt.“
Sie legte den Zettel mit den Aufgaben beiseite und schloss die Augen. Kein Druck, keine Forderung – nur für diesen Augenblick.
Und da war er wieder: der Frieden, der nichts verändern musste, um vollkommen zu sein.
Ohne Maske
Am nächsten Tag traf Johanna ihre Kollegin Anna in der Mittagspause. Sie gingen gemeinsam ein Stück die Straße entlang, jede mit einem Coffee-to-go in der Hand. Normalerweise redeten sie über Belangloses: Projekte, Kollegen, das Wetter. Doch diesmal spürte Johanna den Impuls, ehrlicher zu sein.
„Weißt du, Anna,“ begann sie zögerlich, „manchmal habe ich das Gefühl, dass mir alles zu viel wird. Ich wirke vielleicht ruhig, aber in mir gibt es auch Zweifel und Ängste.“
Anna sah sie überrascht an. Johanna hatte in ihren Augen immer wie jemand gewirkt, der alles im Griff hatte. „Echt? Das hätte ich nie gedacht.“
Johanna nickte. „Früher hätte ich versucht, das zu verstecken. Aber ich merke mehr und mehr: Wenn ich meine Schwächen einfach da sein lasse, ohne sie zu bekämpfen, dann werden sie leichter. Irgendetwas Größeres trägt sie für mich.“
Anna runzelte die Stirn, dann fragte sie vorsichtig: „Meinst du … so etwas wie Gott?“
Johanna lächelte. „Man könnte es so nennen. Für mich ist es wie eine stille Gegenwart. Sie verurteilt nicht, sie nimmt einfach auf. Und in dieser Stille ist es, als wäre ich schon ganz – mit allem, was ich bin, auch mit meinen Unsicherheiten.“
Anna schwieg. Ihre Augen wurden weich. „Das klingt … befreiend. Ich verbringe so viel Energie damit, meine Schwächen zu verstecken. Vielleicht sollte ich das auch mal probieren.“
Sie gingen weiter, beide schweigend, aber diesmal war das Schweigen kein Abstand, sondern Nähe.
Johanna fühlte eine tiefe Erleichterung. Sie hatte zum ersten Mal offen ausgesprochen, was sie sonst verschwiegen hätte. Und es war nichts Schlimmes geschehen – im Gegenteil: Ihre Ehrlichkeit hatte etwas geöffnet, nicht nur in ihr, sondern auch in Anna.
„Die Stille,“ dachte Johanna, „gibt mir Mut, keine Maske mehr zu tragen. Sie zeigt mir, dass ich nicht perfekt sein muss, um verbunden zu sein.“
Ein Kreis wird still
Ein paar Tage später saß Johanna mit einigen Kolleginnen und Kollegen in einem Besprechungsraum. Es war einer dieser Termine, die normalerweise von Spannungen geprägt waren: zu viele Meinungen, zu wenig Zeit, jeder wollte recht behalten.
Schon nach wenigen Minuten erhitzten sich die Stimmen. Zwei Kollegen stritten sich über den Ablauf eines Projekts, die eine pochte auf Regeln, der andere wollte alles anders machen. Der Rest des Tisches wirkte genervt, manche rollten mit den Augen, andere warfen nervöse Blicke auf die Uhr.
Johanna spürte, wie die alte Unruhe in ihr aufstieg: Gleich kippt die Stimmung. Ich müsste etwas sagen, um zu vermitteln …
Doch dann erinnerte sie sich an das, was sie im Supermarkt und auf dem Parkplatz erlebt hatte. Sie atmete tief ein.
Auch hier ist dieselbe Stille, dachte sie. Nicht nur in mir, sondern in jedem von uns. Ich erinnere mich für uns alle.
Sie lehnte sich leicht zurück, legte die Hände locker auf den Tisch und lauschte – nicht nur den Worten, sondern auch dem Raum dahinter.
Sie legte keine eigene Bedeutung auf die Szene, wollte nichts erzwingen. Sie war einfach da, verbunden mit dem stillen Frieden, der alles trug.
Und langsam geschah etwas Merkwürdiges: Die Stimmen wurden leiser. Einer der Streitenden hielt inne, seufzte und sagte: „Vielleicht sollten wir erst mal einen Schritt zurückgehen.“
Die andere nickte widerstrebend, aber doch spürbar erleichtert. Ein kleiner Riss im Kampf war entstanden, und durch diesen Riss sickerte Ruhe in den Raum.
Es war kein großes Wunder, kein sofortiges Einvernehmen. Aber die Atmosphäre veränderte sich. Die Spannung löste sich, und die Runde fand in ein sachlicheres, ruhigeres Gespräch zurück.
Johanna sagte kein Wort. Sie hatte nichts erklärt, nichts vorgeschlagen. Aber sie wusste: Die Stille hatte gehandelt.
Auf dem Heimweg dachte sie: Es stimmt. Diese Kraft wirkt nicht nur zwischen mir und einem Menschen. Sie kann ganze Räume berühren. Gruppen, Gemeinschaften, vielleicht sogar die Welt.
Ein leises Staunen erfüllte sie. Für Johanna war es wieder eines dieser kleinen Wunder, die größer waren, als sie aussahen.
Die Wahl im Augenblick
Johanna saß am Abend auf einer Bank am Stadtrand. Vor ihr ging die Sonne unter, ein leuchtender Ball, der den Himmel in Gold und Rot tauchte. Menschen kamen vorbei, sprachen, lachten, schauten in ihre Telefone. Doch in ihr war es still.
Sie dachte an alles, was sie in den letzten Monaten erlebt hatte: Die verhinderte Fahrt zum Fluss, den Sturm im Wald, die Bahnfahrten voller Lärm, die Warteschlange im Supermarkt, den Streit um Erdbeeren und Parkplätze, die Begegnungen mit Freunden und Fremden. Kleine Szenen, unscheinbar – und doch hatte jede von ihnen sie tiefer in die Stille geführt.
Jetzt wusste sie: Diese Stille war keine Technik, kein Zustand, den man halten musste. Sie war das Leben selbst, die Quelle, die immer da ist. Und jeder Mensch trägt sie in sich – wie ein leuchtendes Geheimnis, das nur darauf wartet, erinnert zu werden.
Jeder hat die Wahl, dachte sie. In jedem Augenblick. Entweder weiterzustreben, immer dem Nächsten nachzulaufen … oder sich mit dem zu verbinden, was einen längst trägt.
Sie schloss die Augen, atmete tief und ließ sich in diese Gegenwart sinken. Es war wie in die Arme einer Liebe zu fallen, die nie etwas gefordert hatte. Hier war kein Mangel, kein Druck, kein Kampf. Hier war Erfüllung – jetzt, schon immer.
Und als sie die Augen wieder öffnete, war die Welt dieselbe – Häuser, Stimmen, Autos, der Himmel, der dunkler wurde. Doch aus ihr strahlte etwas Neues zurück.
Eine neue Hingabe begann. Kein hastiges Jagen mehr, sondern ein stilles Gehen. Ein Weg, der schon erfüllt war, bevor er sich zeigte. Ein inneres Leuchten, das nicht sie trug – sondern von dem sie getragen wurde.
Johanna stand auf. Ihre Schritte waren leicht, ihr Blick offen. Sie wusste nun: In jedem Menschen lebt eine stille Kraft, ein Mut- und Hoffnungslicht, das nie verlischt und immer hilft.
Ist es vielleicht das, wonach alle Menschen suchen?
Von dieser inneren Quelle getragen, konnte sie der Welt jetzt neu entgegentreten …
Schlusswort
Vielleicht hast du dich in Johannas Weg wiedergefunden – in ihren Zweifeln, ihren Stürmen, ihren stillen Wundern. Vielleicht auch nicht. Doch eines ist sicher: Die Stille, die sie getragen hat, lebt auch in dir.
Du musst nicht suchen, nicht kämpfen, nicht warten. Du kannst JETZT einen Augenblick innehalten, die Welt so lassen, wie sie ist – ohne Forderung, ohne Urteil.
Schau, was dann geschieht: Unter dem Lärm deiner Gedanken öffnet sich ein Raum. Nicht leer, sondern lebendig. Warm. Liebevoll. Ein Freund, der nie von deiner Seite weicht.
Dieser Frieden wartet nicht auf eine perfekte Version von dir. Er ist schon da – mitten in deinem Atem, mitten in deinem Herzschlag. Und er trägt bereits Pläne in sich, die dein Leben zur Blüte bringen können, wenn du ihn lässt.
Vielleicht nennst du es Stille. Vielleicht nennst du es Liebe. Manche nennen es Gott. Welchen Namen du auch wählst – es ist dieselbe Quelle, die dich hält.
Und so hast du jetzt die Wahl: weiter im Außen zu suchen … oder dich in die Arme dessen fallen zu lassen, was dich schon immer trägt.
DEIN STILLES LICHT.